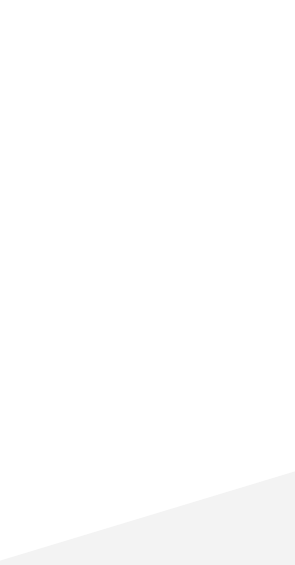»Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte«
(GL 272)
Worte: Raymund Weber (um 1980); Musik: aus dem Gesangbuch von Johann Athanasius Freylinghausen (1708)
Liedportrait von Meinrad Walter
Dieses Lied des Theologen und Germanisten Raymund Weber (geb. 1939), Autor zahlreicher Liedtexte und Mitglied der Gruppe „Singles“ im Erzbistum Köln, ist ein komponiertes Gebet. Gesungen wird es auf eine alte Melodie aus dem Gesangbuch des Hallenser Theologen Johann Athanasius Freylinghausen (1708). Jede der drei Strophen lebt ganz und gar aus dem Gestus des Bittens: Zeige! Komm! Behüte! Hör! Sende! Wende! Und das sind nur die Imperative der ersten Strophe. Wer aber ist angesprochen? Das ist nicht so einfach zu sagen. „Herr“ ist Gottesname für den Schöpfer (Gottvater) wie auch für den Erlöser (Christus) und für den Heiligen Geist, den das Glaubensbekenntnis den „Herrn“ nennt, der lebendig macht (Dominus et vivificantem).
So führt jede der drei Strophen in eine Dynamik, die von Gott (Vater) ausgeht und zugleich weiter drängt. Die erste Strophe deutet schon beim zweiten Abschnitt mit dem Wort „Beistand“ (Tröster, Paraklet – vgl. Jesu Abschiedsreden im Johannesevangelium 14,26) den Geist an und bittet am Ende dann ausdrücklich um das „Feuer des heiligen Geistes“. Die dritte nennt am Schluss den für uns hingegebenen „Sohn“ des Vaters. Und die zweite? Hier führt die poetisch-theologische Entwicklung von Gott hin zu uns, die wir „Werkzeuge“ der göttlichen Verheißung sind mit dem Ziel, „uns selbst und die Welt zu verwandeln“.
Das Wort „Werkzeug“ ist eher ungewöhnlich in einem Kirchenlied. Doch es ist ein Zitat aus der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort heißt es gleich im ersten Abschnitt: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.“ Beim Stichwort „die Welt zu verwandeln“ darf man gewiss auch an die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ über die Kirche in der Welt von heute denken. Dort ist der wichtige Grundsatz zu lesen, dass die Kirche allezeit in der Pflicht steht, „nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“. Genau dies nämlich führt zur „Verwandlung“ der Welt, die unter den Vorzeichen des Glaubens und Liebens steht und die bei jedem selbst anfängt.
„Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte“ – bereits die erste Zeile nennt ein theologisches Problem das oftmals schon bedacht worden ist. Der evangelische Theologe Jürgen Henkys formuliert es in seiner Übertragung des Passionsliedes „Holz auf Jesu Schulter“ (nach einer niederländischen Vorlage) mit den paradoxen Worten: „Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.“ In der Philosophie des 20. Jahrhunderts hören wir kritische Stimmen, vor allem angesichts des unvorstellbaren Leides in Kriegen und ideologisch motivierter Verfolgung. Warum lässt der allmächtige Gott all das zu? Der jüdische Philosoph Hans Jonas stellt sogar die Verbindung von Güte und Allmacht generell in Abrede. Unter dem Eindruck der Schoah kann er sich einen allmächtigen Gott nicht mehr vorstellen. Wenn Gott dieses menschliche Leid zulässt, obwohl der allmächtig ist und eingreifen könnte, ist er nicht gütig. Wenn er aber aus eigener Ohnmacht nicht eingreift, ist er nicht allmächtig. Hans Jonas entscheidet sich daher für ein Gottesbild ohne Allmacht.
Auch dieses Lied gibt keine vorschnellen Antworten auf letzte Fragen. Entscheidend ist die Tonlage des Bittens. Und Raymund Webers „Cantus firmus“ ist letztlich die Bitte um den Geist. Handeln aus dem Geist, so heißt seine Antwort in der zweiten Strophe. Dies ist ein Handeln, das sich inspirieren lässt von den „Worten und Taten“ Jesu, „aus denen wir leben“ (Strophe 3). So gelingt eine überzeugende Balance von Empfangen und Tun. Das erste ist das Empfangen. Aber es bliebe unvollständig, wenn wir die Hände in den Schoß legen und alles dem lieben Gott überlassen. Gott lässt sein „Reich des Friedens“ wachsen wie die Saat im neutestamentlichen Gleichnis. Aber er will uns dabei als Mitwirkende, als „Werkzeuge seiner Verheißung“ sehen.
Entstanden sind die Worte dieses Vertrauensliedes um 1980, und zwar, so der Autor Raymund Weber, im bewussten Rückgriff auf Grundgedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils. Am Anfang stand aber gar nicht dieser Text, sondern ein skandinavisches Lied von Anders Joel Rundt (1879–1971), zu dem ein deutscher Wortlaut gesucht wurde. Raymund Weber hat dann nicht das schwedische Lied übersetzt, sondern einen neuen Wortlaut geschrieben, der auf die Melodie von Rundt passt. Die Arbeitsgruppe Lieder zum neuen Gotteslob hat nur den Liedtext übernommen, allerdings nicht jene Melodie. Vielmehr hat sie die Strophen von Weber mit einer alten Melodie aus dem berühmten Hallenser Gesangbuch von Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) verknüpft, die ein durchaus flüssiges Tempo nahelegt, damit gleich die ersten vier Takte auf einem Atem gesungen werden können.
Die Melodie in e-Moll weist einen fast solistischen Gestus auf, ist aber dennoch für den Gemeindegesang geeignet. Wir begegnen in ihr den typisch barocken Möglichkeiten musikalischer Gestaltung. Gleich die ersten Noten entfalten ein großes Spannungspotenzial, weil der unbekannte Komponist den Leitton dis nicht zum Grundton e zurückführt, sondern über das expressive Intervall dis-g zum fis. Somit erklingen zwei nach barocker Auffassung „leiden-machende“ Halbtonschritte gleich zu Beginn: e-dis und g-fis. Als Ausruf (exclamatio) wirkt dann der Oktavsprung im zweiten Takt, worauf sich eine typisch barocke Seufzerfigur (Suspiratio) anschließt. Die nächsten vier Takte sind eine große, mit Vorhalten durchsetzte Abwärtsbewegung, deren wichtigste Töne c-a-fis-(a-fis-)dis den spannungsvollsten Akkord beschreiben, der auf der Grundlage dieser Tonart e-Moll denkbar ist. Der Abgesang nach dem Doppelstrich intensiviert das Ausdrucksspektrum vor allem mit rhythmischen Mitteln wie etwa der drängenden Punktierung auf „(die) Angst in uns (wende)“. In den beiden letzten Takten kommt die Melodie, die zuvor noch nie beim Zeilenschluss den Grundton erreicht hatte, mit einer fast besänftigenden dreitaktigen Geste zur Ruhe. Deren Rahmenintervall dis-g entspricht exakt der ausdrucksstarken Tonfolge des ersten Taktes, nun aber in gleitender Bewegung und ohne jeglichen Sprung. Zuvor aber erklingt eine ähnlich expressive Tonfolge wie am Beginn: h-fis-g-dis-e heißt sie jetzt. Betrachtet man sie näher, entpuppt sie sich sogar als die Tonfolge des Anfangs, nur von rückwärts gelesen und beim ersten Ton eine Oktav höher beginnend! Dieses musikalische Spiel heißt „Krebsgang“ – eine Art musikalischer „Umkehr“, die Komponisten wie Johann Sebastian Bach sogar als musikalisch-theologische Vokabel der Umkehr verwenden.
Kein geringerer als der Schriftsteller Thomas Mann hat diesem kompositorischen Prinzip in seinem Roman „Buddenbrooks“ sogar ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Lübecker Organist Edmund Pfühl hatte „eine Melodie komponiert, welche vorwärts und rückwärts gelesen, gleich war, und hierauf eine ganze ‚krebsgängig‘ zu spielende Fuge gegründet“, was er seinem kleinen Orgelschüler Hanno Buddenbrook auf der Orgelempore erklärt. Sein Fazit aber heißt mit hoffnungslosem Kopfschütteln: „Es merkt es niemand.“ – Ein solches „es merkt es niemand“ ist das schlimmste, was der Kirchenmusik passieren kann. Doch vielleicht ist es gar nicht entscheidend, wie viele solche Kunst explizit „merken“, es gibt auch ein eher intuitives Wahrnehmen von musikalischer Qualität. In diesem Lied steckt solche Qualität, in Wort und Ton, und deshalb sollten wir es neu einführen und singen.